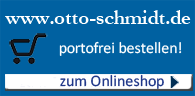Die deutsche Wirtschaft steht vor großen Umbrüchen durch Digitalisierung, Klimaschutz und Deglobalisierung. Lieferketten werden breiter aufgestellt. Die Gesundheitsbranche steht vor den Herausforderungen der Spezialisierung. Banken und Versicherungen müssen mit der Digitalisierung ihrer Kunden Schritt halten. Automobilindustrie und Automobilzulieferer kämpfen mit den Veränderungen der Elektromobilität.
Wie die Schwerpunkt-Ausgabe des Arbeits-Rechtsberater zum Thema „Arbeitsrecht in der Krise“ (ArbRB 8/25) deutlich macht, bringt dieser Wandel erhebliche Herausforderungen mit sich. Herausforderungen, die unter dem Mantel der Kurzarbeit lange versteckt wurden. Dabei geht es nicht nur um einen Wegfall von Arbeitsplätzen. Erkennbar ist, dass auf den verbleibenden Arbeitsplätzen nicht mehr alle Beschäftigten mit ihren vorhandenen Qualifikationen beschäftigt werden können. Das gilt selbst dann, wenn in Fort- und Weiterbildung investiert wird. Hier mĂĽssen Wege des sozialverträglichen Personalabbaus gefunden werden, die mehr als die „klassische“ Abfindung kennen. Zu versuchen ist, interne und externe Einheiten aufzubauen, die dem Ziel dienen, aus Arbeit in Arbeit zu wechseln.
Der Erfolg hängt in vielen Fällen davon ab, dass Arbeitnehmervertreter rechtzeitig eingebunden werden. Dabei geht es nicht nur um die Beteiligungsrechte aus § 17 KSchG, §§ 106, 111, 112 BetrVG. Vielmehr müssen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter gleichermaßen bereit sein, Kompromisse einzugehen und gemeinsam Verantwortung für die Transformation eines Unternehmens oder Konzerns zu übernehmen. Denn die aktuellen Herausforderungen können vielfach nur durch eine grundlegende Neuausrichtung mit einer Anpassung der Arbeits- und Vergütungsstrukturen gemeistert werden.
Geht es um die Reduzierung von Personal, ist es ebenso wichtig, nicht nur Powerpoint-Folien zur Grundlage einer Diskussion über die Zukunft zu nutzen. Hier werden Abbauziele häufig nur aus Benchmarks oder dem Produkt der Anzahl von Full Time Equivalents (FTE) und dem Durchschnittsgehalt dieser Beschäftigten abgeleitet. Es fehlt eine detaillierte Soll-Struktur, in der diese FTE mit Funktionen und Aufgaben verknüpft werden, so dass erkennbar wird, dass das künftige Geschäftsmodell mit den geplanten FTE-Zahlen auch funktioniert. Ist das der Fall, muss mit Mut, Fantasie und sozialer Kompetenz die Zukunftsfähigkeit des betroffenen Unternehmens gesichert werden.
Hinweis der Redaktion:
Weitere Beiträge zum Thema finden Sie in der Ausgabe 8/25 des Arbeits-Rechtsberaters (auch abrufbar im Gratis-Test unserer Datenbank + KI), einer Schwerpunktausgabe zum Thema: „Krise als Chance – Umstrukturierung und Personalabbau rechtssicher gestalten„. Lesen Sie hier:
- wie Sozialpläne helfen können, den Wandel zu gestalten, und wann es keine Alternative hierzu gibt (Marquardt/Müh, ArbRB 2025, 237),
- welche Chancen Freiwilligenprogramme bieten und wie man diese am besten aufsetzen sollte (Grimm/Schwanke, ArbRB 2025, 243),
- was unter einer „wertschätzenden Restrukturierung“ zu verstehen ist und welche Vorteil Transformationseinheiten bieten (Göpfert/Meyerhoff, ArbRB 2025, 247),
- welche aktuellen Entwicklungen beim Betriebsübergang (Schewiola/Soltysiak, ArbRB 2025, 250) und bei Massenentlassungen (Niklas, ArbRB 2025, 253) zu berücksichtigen sind,
- welche individual- und betriebsverfassungsrechtliche Auswirkungen die Insolvenz eines Unternehmens hat (Markowski, ArbRB 2025, 257)Â und
- welche Folgen die Insolvenz einer Partei auf die Unterbrechung arbeitsgerichtlicher Verfahren hat (Tiedemann, ArbRB 2025, 261).