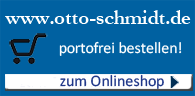Die Frage, ob gleiche oder sehr ähnliche Tätigkeiten auch gleich vergütet werden müssen, beschäftigt HR-Abteilungen regelmäßig – insbesondere in tarifgebundenen Unternehmen. Die jüngste Entscheidung des BAG vom 26.2.2025 – 4 ABR 21/24, ArbRB online, gestützt auf ein Urteil des BVerfG vom 11.12.2024 – 1 BvR 1109/21, ArbRB 2025, 72 (Grimm/Krülls), sorgt in diesem Zusammenhang für Klarheit – und rückt gleichzeitig die Rolle der Tarifautonomie wieder ins Zentrum.
Der Fall: Zwei Berufe, ähnliche Aufgaben – aber ungleiche Bezahlung
Im konkreten Fall ging es um eine Mitarbeiterin, die in einem Krankenhaus zunächst in der Patientenaufnahme arbeitete und nach ihrer Versetzung in den ambulanten Operationssaal (AOP) als Medizinische Fachangestellte (MFA) tätig war – Seite an Seite mit Operationstechnischen Assistenten (OTA). Beide Berufsgruppen übernahmen vergleichbare Aufgaben im OP. Der Arbeitgeber wollte die versetzte Mitarbeiterin in die Entgeltgruppe 6 eingruppieren, was dem Tarifvertrag für MFA entsprach. Der Betriebsrat widersprach: Bei im Wesentlichen gleichen Tätigkeiten müsse auch die Eingruppierung identisch sein – also zumindest Entgeltgruppe 7, wie bei OTA.
Die Entscheidung: Ausbildung zählt – auch bei gleicher Tätigkeit
Das BAG folgte der Argumentation des Arbeitgebers. Ausschlaggebend sei nicht allein die Tätigkeit, sondern auch die tariflich vorgesehene Differenzierung nach Ausbildung. Selbst bei nahezu identischer Tätigkeit könne eine unterschiedliche Eingruppierung gerechtfertigt sein – sofern sie nicht willkürlich ist. Die Richter bezogen sich dabei direkt auf die Entscheidung des BVerfG, das der Tarifautonomie ausdrücklich einen hohen Schutz eingeräumt hat.
Die Tarifvertragsparteien sind demnach bei der Normsetzung zwar an den allgemeinen Gleichheitssatz gebunden. Diese Grenze der Tarifautonomie folgt unmittelbar aus der Verfassung. Bei Tarifnormen, deren Gehalte im Kernbereich der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen liegen und bei denen spezifische Schutzbedarfe oder Anhaltspunkte für eine Vernachlässigung von Minderheitsinteressen nicht erkennbar sind, ist die gerichtliche Kontrolle am Maßstab des Art. 3 Abs. 1 GG aber auf eine Willkürkontrolle beschränkt.
Eine solche Willkür der Tarifvertragsparteien ist nicht schon dann zu bejahen, wenn sie unter mehreren Lösungen nicht die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung treffen. Tarifnormen sind nur dann willkürlich, wenn die ungleiche Behandlung der Sachverhalte nicht mehr mit einer am Gerechtigkeitsgedanken orientierten Betrachtungsweise vereinbar ist, wo also ein einleuchtender Grund für die Differenzierung fehlt. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn die Unsachlichkeit der Differenzierung evident ist.
Bedeutung fĂĽr die Praxis: Tarifautonomie bleibt stabiler Eckpfeiler
Für Personalverantwortliche bedeutet dieses Urteil vor allem eins: Die Gestaltungsspielräume der Tarifvertragsparteien bleiben groß. Entscheidend ist, dass Entgeltgruppen nachvollziehbar begründet sind – z. B. durch Qualifikationen, Ausbildungswege oder berufsrechtliche Rahmenbedingungen. Solange eine sachliche Differenzierung erkennbar ist, ist auch eine ungleiche Bezahlung rechtlich zulässig.
Worauf HR jetzt achten sollte
- Tarifbindung ernst nehmen: In tarifgebundenen Betrieben sind die Vorgaben der Tarifverträge maßgeblich – auch wenn sie auf den ersten Blick Ungleichheiten erzeugen. Diese sind rechtlich zulässig, solange sie hinsichtlich geregelter Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen nicht evident unsachlich oder willkürlich sind.
- Mitbestimmung beachten: Bei nicht tarifgebundenen Unternehmen bleibt die betriebliche Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG essenziell. Hier müssen Entgeltsysteme jedoch den Gleichheitssatz ohne Einschränkung einhalten – also besonders sorgfältig konzipiert werden.
- Transparenz schaffen: Auch wenn das Recht auf Seiten des Arbeitgebers ist, ist die Akzeptanz bei Arbeitnehmern ein wichtiges Thema. Personalabteilungen sind gut beraten, die Hintergründe tariflicher Eingruppierungen aktiv zu erklären – besonders in gemischten Teams mit ähnlichen Aufgaben, aber unterschiedlicher Bezahlung.
Fazit
Die Entscheidung des BAG stärkt die Rolle der Tarifvertragsparteien – und schafft Sicherheit für HR im Umgang mit tariflich geregelten Eingruppierungen. Für Personalverantwortliche bedeutet das: Klare rechtliche Leitplanken, aber auch die Verpflichtung, faire und nachvollziehbare Vergütungssysteme umzusetzen – und dabei die Kommunikation mit den Mitarbeitern nicht zu vernachlässigen.
Siehe auch Kleinebrink, Rechtmäßige Ungleichbehandlung in Tarifverträgen, ArbRB 2025, 111.