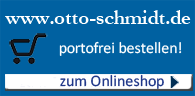Mit seiner Entscheidung C-655/23 vom 04.09.2025 hat der EuGH ein weiteres Vorabentscheidungsverfahren eines deutschen Obergerichts zur DSGVO beantwortet. Im Zentrum stand ein DatenschutzverstoĂź im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens.
In den traditionellen arbeitsrechtlichen „Empörungsblasen“ hat die „DSGVO“ das „AGG“ ohne Frage mittlerweile vom ersten Platz verdrängt.
Warum es bei dem Thema trotzdem eigentlich mehr „grau“ als „schwarz oder weiĂź“ gibt, habe ich daher kurz vorab in der Einleitung skizziert. Auch, warum daher der eine oder andere aktuelle Ansatz etwas ĂĽber das Ziel hinauszuschieĂźen scheint. (siehe unter A.).
Wem all das ohnehin bereits klar ist, springt gleich direkt auf die Entscheidung. (siehe unter B.). Â
Warum ein „Bewerbungsverfahren“ in der Finanzbranche ab und an beim BGH und nicht beim BAG landet, schildere ich neben dem Sachverhalt dort – als sozialversicherungsrechtlichen“Beifang“ – kurz vorab. Â (siehe unter B I. und II.).Â
Die Entscheidung zeigt zum einen auf, welche MaĂźnahmen zur Durchsetzung des Beschäftigungsdatenschutzes ergänzend auf nationaler Ebene bereitstehen. (siehe unter B III.1). Â
Sie beinhaltet zudem einige wichtige Klarstellungen zum Verhältnis von Verschulden und Schadenshöhe.  Mit diesem Ansatz lässt sich missbräuchliches „Hopping“ vermeiden, ohne gleichzeitig einen Freifahrtschein fĂĽr fortgesetzte vorsätzliche Datenschutzverstöße in Form einer starren „Einheitspreisliste“ zu liefern. Welche Stellschrauben dazu – in Abweichung zu § 253 BGB – fĂĽr die Höhe des immateriellen Schadens in den Blick zu nehmen sind, findet sich schlieĂźlich am Ende des Beitrags (siehe unter B III.2),
der mit einem kurzen Fazit endet (siehe unter C.).Â
A. Hintergrund
In den traditionellen arbeitsrechtlichen Empörungsblasen hat das Thema DSGVO das Thema AGG ohne Frage mittlerweile vom ersten Platz verdrängt.Â
Das jeweilige gegenteilige „Blasendogma“ ist dabei trotz Themenwechsel ĂĽber die Jahre dasselbe geblieben:Â
Die AGG- bzw. DSGVO-Empörungsblasen….
Eine Blase, die weiterhin ein Vollzugsdefizit beim Schutz elementarer Grundrechte feststellt. Und die daher mehr Ressourcen und Schutzinstrumente einfordert.Â
Eine andere Blase, die das jeweils maĂźgebliche Regelwerk vor allem als „BĂĽrokratiemonster“ ausmacht. Eines, das so vor allem sogenannte AGG- bzw. DSGVO-Hopper fĂĽr ihre eigenen Zwecke schamlos ausnutzen können.Â
…und ihre zum Teil nicht ganz so selbstlosen Motive
Regelmäßig haben die jeweiligen „Dogmen“ beider Blasen allerdings auch einen nicht ganz so selbstlosen Hintergrund: Â
Zum einen erweitern mehr Ressourcen und Schutzinstrumente stets auch den Einfluss und die eigene Bedeutung der Institutionen, die sie einfordern. Ă„hnliche Phänomene kennt man aus jedem Unternehmen, wenn einzelne Ressorts um die Bedeutung ihrer „Themen“ – und vor allem die dafĂĽr erforderlichen Einzelbudgets als Teil eines stets limitierten Gesamtbudgets – streiten. Â
FĂĽr die jeweils andere „Blase“ sind die so instrumentalisierten „Hopper“ ein willkommenes politisches Vehikel, um durchaus elementare SchutzbedĂĽrfnisse der Allgemeinheit – insbesondere im digitalen Kontext – beiseiteschieben zu können. Nicht selten, um diese BedĂĽrfnisse so eigenen wirtschaftlichen oder politischen Interessen unterordnen zu können.Â
„Hard cases make bad law“Â
mag der eine oder andere durchaus manchmal etwas ĂĽberrascht denken, wenn bei Vorlagefragen an den EuGH so ggf. der Schutz ganzer Teilbereiche der DSGVO – wie bspw. jĂĽngst die Betroffenheitsrechte – zur Disposition gestellt werden. Dass sich dieser Ansatz aufgrund ihrer expliziten Absicherung im Wortlaut des Art. 8 Abs. 2 Satz 2 GrCH – zurĂĽckhaltend formuliert – dogmatisch nicht gerade unbedingt aufdrängt, ist im Rahmen eines anderen, hier verlinkten Blog Beitrags von Anfang Juli bereits anhand mehrerer obergerichtlicher Entscheidungen aufgezeigt worden. Vor allem, weil – wie dort näher ausgefĂĽhrt – stattdessen mit variablen Schadenshöhen eine Alternative fĂĽr deutlich passgenauere Einzelfalllösungen in der Praxis zur VerfĂĽgung steht.Â
Struktueller Missbrauch – wie ihn zahlreiche „Hopper“ unbestritten betreiben – lässt sich nach allgemeinen Praxiserfahrungen auch dadurch beseitigen, dass sich das dahinter stehende „Geschäftsmodel“ nicht mehr rechnet.
Jenseits der sozialen Medien ist die reale Welt somit bekanntlich selten schwarz oder weiĂź, sondern meist grau.Â
Insoweit lohnt auch hier ein Blick, ob die jĂĽngste Entscheidung des EuGH aus dem vergangenen Monat diesem Anspruch gerecht wird und wie das eine oder andere einzuordnen ist.
B. Neues und Altbekanntes: Einzelne Aspekte der Entscheidung des EuGH
I. Ausgangssachverhalt: Datenpanne im Bewerbungsverfahren
Dem von BGH vorgelegten Fall lag folgender einfacher Sachverhalt zugrunde:
Ein Mitarbeiter aus dem Finanzbereich hatte sich bei einem anderen Konkurrenzunternehmen beworben und dort einen VergĂĽtungswunsch adressiert. Die Kommunikation erfolgte ĂĽber das soziale Netzwerk „XING“.Â
Die Antwort der Personalabteilung auf die Bewerbung wurde aber an einen ehemaligen Kollegen des Bewerbers versandt. Dieser kannte den Bewerber zufällig persönlich, wies ihn auf den Vorgang kurz hin und fragte bei diesem nach, ob er sich aktuell anderweitig bewerbe. Der Bewerber nahm darauf das Unternehmen auf Schadensersatz und Unterlassung in Anspruch. Insbesondere, weil Vertrauliches so ggf. im „Markt“ die Runde mache und fĂĽr ihn so nicht mehr steuerbar sei.Â
Im Mittelpunkt des sodann seit 2020 gefĂĽhrten Verfahrens stand dabei neben der Zulässigkeit des Unterlassungsanspruch vor allem die Höhe eines möglichen immateriellen Schadens, den die Eingangsinstanz mit EUR 1000,- bewertet hatte.Â
Im Instanzenzug stand dabei neben einer „Erheblichkeitsschwelle“ auch in Frage, ob das punktuelle, offensichtlich einmalige Versehen der Personalabteilung unter dem Aspekt der Geringwertigkeit des Verschuldens auf der Ebene der Anspruchshöhe zu berĂĽcksichtigen sei.Â
Mithin klassische Bemessungsfragen des § 253 BGB.
II. Vorlage des BGH an den EuGH fĂĽr eine eigentlich „arbeitsrechtliche“ Fragestellung?
Kurzer Exkurs zum „Selbstständigen Finanzvermittler“Â
Wer den Fall nicht bereits vor einigen Jahren in den Vorinstanzen verfolgt hatte, wird hier zunächst zu Recht die Frage stellen, warum ein „DatenschutzverstoĂź im Bewerbungsverfahren“ beim Vorlagebeschluss beim BGH (VI ZR 97/22 vom 26.9.2023) bzw. zuvor beim OLG Frankfurt (13 U 206/20 vom 2.3.2022) und LG Darmstadt (13 O 244/19 vom 26.5.2020) zur Entscheidung anstand.Â
Denn bekanntlich sind die Arbeitsgerichte gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 c ArbGG auch fĂĽr AnsprĂĽche im Bewerbungsverfahren zuständig.Â
Hintergrund fĂĽr die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte dĂĽrfte eine wohl im Raum stehende Tätigkeit des Klägers als „selbstständiger Finanzvermittlers“ sein. BranchenĂĽbergreifend sind die Anforderungen der Sozialgerichte an eine „Selbständigkeit“ – bei einer Tätigkeit fĂĽr nur eine Einheit – mittlerweile oft eine unĂĽberwindbare HĂĽrde.Â
Die damit ĂĽblicherweise verbundenen Streitfragen ĂĽber eine „Eingliederung in die Betriebsorganisation“ und den Umfang des „Amtsermittlungsgrundsatz“ prägen daher die meisten jĂĽngeren Entscheidungen des Bundessozialgerichts. Die zum Teil fĂĽr die Finanzwirtschaft geltenden Besonderheiten hätten daher durchaus das Potential fĂĽr einen eigenen arbeitsrechtlichen Blog-Beitrag.Â
Wer sich damit näher auseinandersetzen möchte, für den lohnt die Lektüre der aktuellen Entscheidung des BSG vom 9.4.2025 (B 12 BA 13/24 B) des hessischen LSG vom 22.02.2024 (L 8 BA 36/21).
III. „Neues“ und „Altes“ zum Datenschutz:
Einzelaspekte der Entscheidung C-655/23 vom 04.09.2025:
Aus datenschutzrechtlicher Sicht sind vor allem folgende Klarstellungen des EuGH auf die Vorlagefragen des BGH von Bedeutung:
1. „Neues“:Â
Unterlassungsanspruch, ergänzender Rückgriff auf allgemeine Anspruchsgrundlagen
Der EuGH stellt zunächst auf die erste Vorlagefrage des BGH klar, dass die DSGVO selbst keinen präventiven Rechtsbehelf beinhaltet, mit dem ein Unterlassungsanspruch durchgesetzt werden kann.Â
Insbesondere lasse sich dieser nicht aus Art. 16, 17 DSGVO ableiten (Vgl. EuGH a.a.O.Rz. 43)Â
a. Hinweis des EuGH zum Verhältnis zum nationalen Recht
Unabhängig davon weist der EuGH sodann aber unter Bezug auf Art. 79 DSGVO und seine bisherige Rechtsprechung (EuGH C-21/23 vom 4.10.2024 („Lindenapotheke“), dort Rz. 59) darauf hin, dass
der Unionsgesetzgeber jedoch keine umfassende Harmonisierung der bei einem Verstoß gegen die Bestimmungen dieser Verordnung zur Verfügung stehenden Rechtsbehelfe vornehmen wollte und insbesondere solche Rechtsbehelfsmöglichkeiten nicht ausgeschlossen hat (EuGH a.a.O. Rz. 48)
Mit Blick auf den 10. Erwägungsgrund der DSGVO führt der EuGH zudem aus, dass solche Optionen die praktische Wirksamkeit der Bestimmungen DSGVO verstärken und damit das mit dieser Verordnung angestrebte hohe Schutzniveau für die betroffenen Personen in Bezug auf die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verbessern. (EuGH a.a.O. Rz. 50 ff.)
Im konkreten Fall bedeutete dies, dass zur Durchsetzung und Absicherung von Rechten aus der DSGVO auch ein allgemeiner Rechtsbehelf, hier die vom Kläger erhobene Unterlassungsklage, anhängig gemacht werden kann.Â
Materieller AnknĂĽpfungspunkt kann dafĂĽr dann auch eine allgemeine Anspruchsgrundlage sein, im vorliegenden Fall – mit Blick auf die explizite Vorlagefrage des BGH – also bspw. § 1004 analog iVm Art 2 (1) GG.
b. DarĂĽber hinaus gehende Auswirkungen fĂĽr die Praxis
FĂĽr die Praxis ist das vor allem deshalb bedeutsam, weil es somit als gesicherte Rechtsprechung des EuGH angesehen werden kann, dass flankierend auch auf allgemeine nationale Anspruchsgrundlagen auĂźerhalb der DSGVO ergänzend zurĂĽckgegriffen werden kann.Â
Mit Blick auf Art. 84 DSGVO ist dies in den meisten datenschutzrechtlichen Kommentierungen auch bezĂĽglich anderer materieller Anspruchsgrundlagen – wie bspw. die Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung – bereits lange so bewertet worden.
Mit der Entscheidung im Anschluss an die Vorlagefrage dĂĽrften letzte Restzweifel, die ältere unterinstanzliche Entscheidungen kurz nach Inkrafttreten der DSGVO zunächst mit Blick auf die „Vollharmonisierung“ gestreut hatten, damit nunmehr endgĂĽltig beseitigt sein.Â
Hierin liegt vor allem der aus der Entscheidung abzuleitende „neue“ Erkenntniswert fĂĽr die Praxis.Â
2.. (und nicht nur) „Altes“
Anforderung an Schaden und zur BerĂĽcksichtigung von Verschulden
Weniger „bahnbrechend“ sind hingegen zum Teil die Erkenntnisse zu den weiteren Vorlagefragen. Denn im Anschluss an die bereits zwei Jahre zurĂĽckliegende Vorlage hatte der EuGH bereits in anderen Verfahren wesentliche Klarstellungen vorgenommen. Â
a. Keine „Erheblichkeitsschwelle“ fĂĽr den immateriellen Schadensersatzanspruch…
Dies gilt zum einen fĂĽr die Frage einer „Erheblichkeitsschwelle“. Gerade weil – wie der BGH in der Vorlage deutlich macht – Sorge oder Ă„rger als Teil des allgemeinen Lebensrisikos bewertet werden könnten.Â
Hier macht der EuGH in der Entscheidung (EuGH a.a.O., Rz 61ff) erneut deutlich, dass ein immaterieller Schaden auchÂ
„negative GefĂĽhle umfasst, die die betroffene Person infolge einer unbefugten Ăśbermittlung ihrer personenbezogenen Daten an einen Dritten empfindet, wie z. B. Sorge oder Ă„rger, und die durch einen Verlust der Kontrolle ĂĽber diese Daten, ihre mögliche missbräuchliche Verwendung oder eine Rufschädigung hervorgerufen werden“. Â
und verweist auf die Urteile EuGHÂ C-590/22 vom 20.06. 2024 („PS“), Rz. 32, 35 und 36, und C-200/23 vom 4. 10. 2024 („Agentsia po vpisvaniyata“), Rz. 143, 144 und 155) Â
Das ist – nach traditionellen deutschen Verständnis – zunächst ein wesentlicher Unterschied zu § 253 BGB.
b. … und die Bewertungsspielräume der InstanzgerichteÂ
Voraussetzung ist auf der Grundlage dieser Entscheidungen zudem,Â
„dass die Person nachweist, dass sie solche GefĂĽhle samt ihrer negativen Folgen aufgrund des in Rede stehenden VerstoĂźes gegen die DSGVO empfinde. Dies zu prĂĽfen sei weiterhin Sache des angerufenen nationalen Gerichts.“Â
Bei „minimalinvasiven“ Verletzungen wie dem kurzzeitigen Verschwinden von Kreditunterlagen in der Warenausgabe (Vgl. EuGH C-687/21 vom 15.1.2024 („Media Markt“) dĂĽrfte dieser Nachweis gegenĂĽber einem Gericht naturgemäß (zu Recht) schwerer fallen als bei mehrfachen und andauernden Verletzungen, mit denen sich bei objektiver Betrachtung regelmäßig deutlich „negativere“ GefĂĽhle – auch mit Blick auf die eigene Machtlosigkeit – vermitteln lassen dĂĽrften.Â
Insbesondere Richterinnen und Richter in den Tatsacheninstanzen, die ĂĽber die Jahre auch in anderen Bereichen täglich mit einer Vielzahl ganz unterschiedlicher Lebenswirklichkeiten konfrontiert sind, haben meist ein gutes GespĂĽr, was fĂĽr ein „Fall“ ihnen gerade präsentiert wird. Der Ansatz des EuGH bietet – entgegen der einen oder anderen kritischen Stimmen –  insoweit das dafĂĽr notwendige flexible Instrumentarium.Â
Zum einen, weil dieser Ansatz einen Anspruch an sich nicht bereits per se ĂĽber einen so unbestimmten Rechtsbegriff wie einer „Erheblichkeitsschwelle“ vollständig ausschlieĂźt. Â
Zum anderen, weil er stattdessen bei der Schadenshöhe den Gerichten so die notwendige „Beinfreiheit“ lässt, den ihnen präsentierten Sachverhalt einzelfallbezogen und passgenau – ĂĽber die Höhe des Schadensersatzes – zu entscheiden. Â
Das gilt umso mehr fĂĽr Arbeitsgerichte, bei denen Parteien erstinstanzlich ihre Kosten ohnehin auch beim Obsiegen selbst tragen. Und wo selbst rechtschutzversicherte Parteien insoweit regelmäßig Ihren dreistelligen Selbstbehalt tragen… Ein „Hopper-Modell“ trägt das nicht.Â
c. Zur NichtberĂĽcksichtung des Verschuldens …
Mit Blick auf diesen Ansatz sind auch die weiteren AusfĂĽhrungen „zur etwaigen BerĂĽcksichtigung des Verschuldens“ grundsätzlich stimmig.
Gleichwohl benötigen sie – mit Blick auf den Kontext der Vorlagefrage und ihren ĂĽber den eigentlichen Fallbezug hinausgehenden Fragewortlaut – einige wenige Erläuterungen zu ihrer grundsätzlichen Einordnung.
Allgemeiner Ausgangspunkt – nach deutschem Schadensrecht –  ist dabei zwar zunächst folgender:
Der Grad des Verschuldens eines Verstoßes kann sich nach deutschem Rechtsverständnis gemäß § 253 BGB bei einem immateriellen Schadensersatzanspruch regelmäßig in zwei Richtungen auswirken. Minimales Verschulden kann zur Minderung, Vorsatz zu einem höheren Anspruch führen.
FĂĽr den hier zu entscheidenden konkreten Fall stand aufgrund des eingangs skizzierten Sachverhalts („ein einmaliges Versehen“) aber lediglich eine Minderung im Raum. Dies sollte man – da der EuGH bekanntlich stets darauf hinweist, keine abstrakten Rechtsgutachten zu erstellen- zunächst ein StĂĽckweit im Blick behalten.
aa. keine generalpräventive Straffunktion, keine Anwendbarkeit der Kriterien des Art 83Â
Es ist trotzdem richtig (und wichtig), dass der EuGH in diesem Kontext (EuGH a.a.O. Rz. 69 f.) ebenfalls zunächst nochmals auf seine bisherige Rechtsprechung verweist, wonach auch der vollumfängliche Ausgleich keine Verhängung von Strafschadensersatz erfordert.Â
Und vor allem, dass die betreffenden Kriterien, die Art. 83 DSGVO fĂĽr GeldbuĂźen vorsieht, im Rahmen von Art. 82 DSGVO nicht entsprechend anwendbar sind. (EuGH C-300/21vom 4.5.2023 („Ă–sterreichische Post“) Rz. 57 und 58, sowie C-507/23 vom 4.10.2024 („PateĚ„reĚ„taĚ„ju tiesiĚ„bu aizsardziĚ„bas centrs“),Rz. 34).
Das nimmt nämlich all denjenigen den Wind aus den Segeln, fĂĽr die als potentielle „Hopper“ nicht der Schutz Ihrer Grundrechte, sondern allein deren Monetarisierung im Vordergrund steht. Und die daher fĂĽr etwaige Bezugsgrößen mittelbar daher oft die achtstelligen Vorgaben der Art 83 (4), (5) in Bezug genommen haben.
bb. keine Berücksichtigung einer möglichen Geringfügigkeit eines Verschuldens zwecks Minderung des Ausgleichs des immateriellen Schadens
Gleichzeitig erteilt der EuGH aber auch dem Ansatz eine Absage, das nach seiner Rechtsprechung grundsätzlich vermutete Verschulden (und damit auch den Anspruch) ĂĽber den Aspekt der GeringfĂĽgigkeit ggf. einzuschränken (EuGH a.a.O. Rz. 71 f.) Insoweit fĂĽhrt er insbesondere aus,Â
dass im Rahmen dieser Bestimmung die Haltung und die BeweggrĂĽnde des Verantwortlichen nicht berĂĽcksichtigt werden dĂĽrfen, um der betroffenen Person gegebenenfalls einen Schadensersatz zu gewähren, der geringer ist als der Schaden, der ihr konkret entstanden ist – sei es hinsichtlich der Höhe oder der Form dieses Schadensersatzes (vgl. in diesem Sinne EuGH C-507/23 vom 4. 10 2024 („PateĚ„reĚ„taĚ„ju tiesiĚ„bu aizsardziĚ„bas centrs“) Rz. 42ff.)
 Das ist insoweit konsequent, weil sich die im Zentrum des Ausgleich stehende immaterielle subjektive Beeinträchtigung des Geschädigten (also bspw. die zuvor erwähnte „Sorge“ oder „negativen GefĂĽhle“) sich durch einen geringen Verschuldensanteil fĂĽr den Geschädigten nicht „mindert“.Â
Genauso, wie die zuvor erwähnten „generalpräventiven“ Erwägungen diesen andererseits eben auch nicht „erhöht“.Â
d. ... und der gleichwohl mittelbaren Berücksichtigung von Vorsatz bei der Bewertung der Beeinträchtigung bzw. ihrer Substantiierung?
FĂĽr die Praxis ist zudem ein weiterer Hinweis von nicht zu unterschätzender Bedeutung.Â
aa. auch keine erhöhende Berücksichtigung des immateriellen Schadens durch (wiederholt) vorsätzlicher Verstöße?
Mit Blick auf den konkreten Fall hätte es durchaus genĂĽgt, die Vorlagefrage darauf zu beschränken, ob ein geringfĂĽgiger Verschuldensanteil zu einer Minderung des Falls fĂĽhrt, was der EuGH sodann hier – wie anhand des Wortlauts der Entscheidung aufgezeigt – verneint hat.
Mit Blick auf die gleichwohl 2022 weiter gefasste Vorlagefrage, ob Verschulden „ĂĽberhaupt“ zu berĂĽcksichtigen sei, die der EuGH – zwar fĂĽr den vorliegenden Fall, aber genauso weit gefasst – verneint hat, steht jedoch unweigerlich eine weitere Frage im Raum:Â
Spielt es damit fĂĽr die Bemessung und die Höhe des immateriellen Schadensersatz damit dann letztlich auch keine Rolle mehr, wenn vorsätzlich und ggf. auch wiederholt Datenverstöße erfolgen, weil – unabhängig vom Verschulden – quasi stets dieselbe vorhersehbare „Einheitstaxe“ zu zahlen wäre?
bb. mittelbare Wirkung (wiederholt) vorsätzlicher Verstöße auf die Beeinträchtigung und deren Geltendmachung
Dass ein solcher Ansatz im Ergebnis nur schwer mit dem intendierten individuellen Grundrechtsschutz der DSGVO vereinbar wäre (und damit nicht richtig sein kann) dĂĽrfte auf der Hand liegen.Â
Unabhängig davon, dass sich dieses Ergebnis bei einer Auslegung von „Vorlagefrage“ und „Antwort“ mit Blick auf den konkreten Sachverhalt des Falls nicht aufdrängt, ist dieses Ergebnis aus zwei weiteren GrĂĽnden ebenfalls abwegig:
Zum einen fĂĽhren mehrere Verstöße – anders als der punktuelle EinzelverstoĂź im vorliegenden Fall – im Zweifel auch zu mehreren kumulativen AnsprĂĽchen und damit per se auch zu einer höheren Schadensumme.
Zum anderen liegt auf der Hand, dass es den Betroffenen bei fortwährenden Verstößen um so leichter fallen wird, die (im Zweifel mit den wiederholten Verstößen sich erhöhende) „Sorge“ oder negativen GefĂĽhle auch fĂĽr das Gericht nachvollziehbarer zu substantiieren, als bspw. im Fall eines „kurzfristig nicht auffindbaren Warenkartons“ wie in der bereits erwähnten „Media Markt“ Entscheidung des EuGH. Und somit auch eine Beeinträchtigung seiner/ihrer grundrechtlichen Position aus Art. 2 (1) i.V.m. Art. 1 GG. bzw. Art. 8 (2) GrCh.
AbschlieĂźend spricht auch – unter dem Aspekt eines etwaigen „Hopper“-Missbrauchs“ – rechtspolitisch wenig dafĂĽr, dies gerichtsseitig mit Blick auf die wechselseitigen Substantiierungspflichten und eine ggf. proportional dann ansteigende immaterielle SchadensersatzansprĂĽche.Â
Denn die klassischen „Hopper-Fälle“ zeichnen sich regelmäßig durch punktuelle unbewusste Versehen aus, die sodann einer „Monetarisierung“ zugefĂĽhrt werden.
Diese Gefahr birgt der vorliegende „gestaffelte“ Ansatz nicht. Â
C. Fazit und Ausblick
Mit den vorliegenden Klarstellungen stellt der EuGH den nationalen Gerichten damit ein durchaus flexibel einsetzbares System fĂĽr den Umgang mit dem immateriellen Schadensersatzanspruch aus Art 82 DSGVO zur VerfĂĽgung.Â
Es obliegt insoweit den nationalen Gerichten, es so zu nutzen und fortzuentwickeln, dass es weder Anreize fĂĽr „AGG Hopper“ noch einen Freifahrtschein fĂĽr fortgesetzte vorsätzliche Datenschutzverstöße gemäß einer „Einheitspreisliste“ bietet.   Â
Solle dies gelingen, dann dürften beide Empörungsblasen künftig nach einem neuen Topthema suchen.
Dem Datenschutz wäre es – mit Blick auf seine keinesfalls zu unterschätzende Rolle fĂĽr etwas mehr digitale Souveränität auf individueller, nationaler und kontinentaler Ebene – ohne Weiteres zu wĂĽnschen.