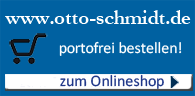Ein Beitrag von Dr. Ulrich Sittard und Dr. Sarah Maria Fröhlingsdorf. Die Autoren sind Rechtsanwälte in der arbeitsrechtlichen Praxisgruppe der internationalen Sozietät Freshfields in Düsseldorf.
Am 6. Juni 2025 hatten die Bundesländer Bremen, Brandenburg, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland einen Entschließungsantrag (BR-Drucksache 239/25) in den Bundesrat eingebracht, der eine umfassende Modernisierung des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) fordert. In seiner Sitzung am 11. Juli 2025 hat der Bundesrat den entsprechenden Entschließungsbeschluss gefasst (BR-Drucksache 239/25(B)).
Ziel dieser Initiative ist es, die betriebliche Mitbestimmung an die Anforderungen der digitalen Arbeitswelt anzupassen. Der Antrag bzw. Beschluss enthält zahlreiche Vorschläge – von virtuellen Betriebsratssitzungen über Mitbestimmungsrechte bei Künstlicher Intelligenz (KI) bis hin zu digitalen Zugangsrechten für Gewerkschaften. Aus Arbeitgebersicht stellt sich aber die Frage, ob das ohnehin schon monströse Betriebsverfassungsrecht damit noch weiter aufgebläht und weitere Bürokratie geschaffen wird.
Digitalisierung als Einfallstor fГјr Mitbestimmungsrechte
Zwar scheint der Vorstoß auf den ersten Blick im Einklang mit dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung zu stehen, der eine Modernisierung der Mitbestimmung im digitalen Zeitalter vorsieht – etwa durch Online-Betriebsratssitzungen und Betriebsversammlungen. Doch geht der Antrag weit über die vom Koalitionsvertrag vorgesehenen pragmatischen Anpassungen hinaus. Vielmehr zielt er auf eine strukturelle Erweiterung der Mitbestimmungsrechte und dies, ohne an anderer Stelle Beteiligungsrechte abzubauen.
Die Länder fordern unter anderem:
- eine Ausweitung des Arbeitnehmerbegriffs auf arbeitnehmerähnliche Personen, insbesondere um solche i.S.v. § 12a TVG,
- neue Mitwirkungsrechte beim Umgang mit Beschäftigtendaten,
- ein Beteiligungsrecht des Betriebsrats nach § 111 BetrVG bei Betriebsübergängen nach § 613a BGB,
- die Möglichkeit zur Betriebsratsgründung in der Plattformökonomie,
- ein digitales Zugangsrecht fГјr Gewerkschaften,
- eine Stärkung der Mitbestimmung bei der Personalplanung und
- einen effektiveren Schutz vor „Union Busting“.
Diese Forderungen folgen der langen Tradition der immer weiter ausgedehnten Mitbestimmung. Statt das BetrVG ausbalanciert an eine veränderte Arbeitswelt anzupassen und z.B. inzwischen völlig unverhältnismäßige Beteiligungsrechte wie das Veto-Recht von Betriebsräten für nahezu jedes IT-Tool nach § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG (verfassungskonform) einzuschränken, bringt der Antrag ausschließlich eine Ausweitung von Mitbestimmungsrechten. Zwar wird im Entschließungsantrag der Rückgang der Betriebe mit Betriebsrat erwähnt – keiner der Beteiligten scheint aber auf die Idee gekommen zu sein, dass „immer mehr Mitbestimmung“ seit Jahrzehnten gesetzgeberische Praxis ist und diesen Trend jedenfalls nicht gestoppt hat.
Nachfolgend werfen wir einen genaueren Blick auf einzelne Forderungen.
Rechtsunsicherheit statt Klarheit
Kritisch zu hinterfragen ist die geplante Änderung des Arbeitnehmerbegriffs. Der Antrag spricht davon „alle Personen zu erfassen, die für einen Betrieb tätig sind“. Dementsprechend sollte der Arbeitnehmerbegriff des BetrVG erweitert werden, insbesondere müssten arbeitnehmerähnliche Personen nach § 12a TVG einbezogen werden. Dies geht offensichtlich zu weit: Alle im Betrieb tätigen Personen würden bspw. auch Selbstständige oder Arbeitnehmer von Dienst- und Werkleistern erfassen. Das AÜG sieht in § 14 Abs. 2 und 3 BetrVG bereits die Vertretung von Leiharbeitnehmern durch den Betriebsrat des Entleiherbetriebsrats vor. Eine darüber hinausgehende Zuständigkeit für „Externe“ ist auch demokratisch schwer zu legitimieren – so würden diese bei ihrem oft kurzzeitigen Einsatz den Betriebsrat regelmäßig nicht mitwählen.
Erweiterung des В§ 111 Satz 3 BetrVG im Kontext digitaler Transformationsprozesse
Ein weiterer Prüfauftrag soll an die Bundesregierung gerichtet werden mit dem Ziel, zu evaluieren, inwieweit § 111 Satz 3 BetrVG dahingehend erweitert werden kann, zusätzliche Tatbestände der Betriebsänderung normativ zu erfassen. Die Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit einer solchen Erweiterung ist mehr als fraglich. Bereits nach geltender Rechtslage kann die Einführung von KI-gestützten Arbeitsmitteln, neuen Softwarelösungen oder sonstigen digitalen Technologien eine Betriebsänderung im Sinne des § 111 Satz 3 BetrVG darstellen – etwa als „grundlegende Änderung der Betriebsorganisation“ oder als „Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden“. Vor diesem Hintergrund scheint eine gesetzliche Ausweitung nicht erforderlich. Eine übermäßige Ausweitung des ohnehin weit gefassten Anwendungsbereichs dürfte zu einer normativen Überdehnung führen und bestehende Abgrenzungsschwierigkeiten weiter verschärfen.
Nicht nachvollziehbar ist auch die Forderung den „einfachen“ Betriebsübergang nach § 613a BGB der Beteiligung nach § 111 BetrVG zu unterwerfen. Beim Betriebsübergang bleibt der Betrieb – der Bezugspunkt des BetrVG – intakt. Teilbetriebsübergänge sind dagegen bereits heute regelmäßig eine Betriebsspaltung und unterliegen der Mitbestimmung nach § 111 Satz 3 Nr. 3 BetrVG.
Mehr virtuelle Betriebsratsarbeit und Betriebsratswahl – gerne, aber mit dem richtigen Timing
Die Forderung nach einer über § 30 Abs. 2 BetrVG hinausgehenden digitalen Betriebsratsarbeit ist völlig richtig. Insbesondere der Umstand, dass Betriebsversammlungen nicht digital stattfinden dürfen, ist vor dem Hintergrund digitaler Townhalls und Jour Fixes im Unternehmensalltag mehr als antiquiert und sorgt faktisch für weniger gelebte Mitbestimmung. Auch digitale Betriebsratswahlen sind sinnvoll – vor dem Hintergrund der spätestens ab Herbst laufenden Vorbereitungen für die Betriebsratswahlen 2026 dürfte diese Forderung für die nächste reguläre Wahl allerdings zu spät kommen. Digitale Lösungen und Tools bis zu den Wahlen im Frühjahr 2026 einzuführen, dürfte kaum möglich sein und würde zu zusätzlicher Rechtsunsicherheit führen.
Gewerkschaftszugang und Datenschutz – ein gefährlicher Spagat
Die Forderung nach einem digitalen Zugangsrecht für Gewerkschaften wirft erhebliche datenschutzrechtliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen auf. Wer kontrolliert die Inhalte? Wie wird der Schutz betrieblicher Kommunikationskanäle gewährleistet? In Zeiten zunehmender Cyberbedrohungen erscheint es leichtfertig, Unternehmen gesetzlich zur Öffnung ihrer digitalen Infrastruktur an eine externe Gewerkschaft zu verpflichten. Arbeitgeber laufen Gefahr, dass interne Systeme für gewerkschaftliche Kampagnen genutzt werden – ohne Möglichkeit zur Einflussnahme. Dies untergräbt gerade bei Konflikten zwischen Gewerkschaften die Neutralität des Arbeitgebers und schafft neue Konfliktlinien im Betrieb.
Gleichzeitig ist der Schutz von Beschäftigtendaten – insbesondere im Kontext von KI – selbstverständlich wichtig. Doch auch hier gilt: Mitbestimmung darf nicht zur Schwächung der IT-Sicherheit und langwieriger Verhandlungsverfahren führen, die Prozesse behindern. Bestehende Mitwirkungsrechte im BetrVG bieten bereits heute einen soliden Rahmen ohne über zu regulieren.
Personalplanung und Weiterbildung
Der Entwurf fordert zur Prüfung auf, wie die Rechte des Betriebsrates in Bezug auf die quantitative und qualitative Personalplanung und Personalbemessung des Arbeitgebers optimiert werden können. Bereits heute hat der Betriebsrat über § 92 BetrVG ein entsprechendes Informations- und Beratungsrecht. Die Personalplanung – und die Verantwortung für die Folgen – ist eine originäre Arbeitgeberaufgabe. Für ein über § 92 BetrVG hinausgehendes Beteiligungsrecht besteht kein Bedürfnis. Es wäre vielmehr überlegenswert, § 92 BetrVG einzuschränken und bspw. im Wirtschaftsausschuss eine jährliche Unterrichtung über die Personalplanung vorzusehen sowie § 92 BetrVG im Übrigen abzuschaffen.
„Union Busting“
Der Schutz vor „Union Busting“ ist dagegen grundsätzlich nachvollziehbar, doch bleibt der Antrag vage, welche konkreten Maßnahmen im digitalen Kontext erforderlich und angemessen wären und warum dies ein Thema im BetrVG sein soll. Bereits heute ist die Behinderung gewerkschaftlicher Arbeit u.U. strafbar und verfassungsrechtlich geschützt. Eine weitere Verschärfung bedarf daher einer sorgfältigen Abwägung.
Kostenfaktor Mitbestimmung – eine unterschätzte Belastung
Neben juristischen Bedenken sind auch die wirtschaftlichen Auswirkungen nicht zu unterschätzen. Eine Ausweitung der Mitbestimmung bedeutet zusätzliche Bürokratie, höhere Kosten und potenzielle Verzögerungen in Entscheidungsprozessen. Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer tiefgreifenden Krise und steht im Wettbewerb mit Nationen (auch in Europa!), die viel weniger arbeitsrechtliche Regulierung und Mitbestimmung vorsehen. Die langwierigen Mitbestimmungsprozesse haben sich längst zum Standortnachteil entwickelt – letztlich sind auch sie aus Unternehmenssicht Bürokratie.
Reform der Betriebsratsstruktur – Flexibilität statt Bürokratie
Die Anpassung von Betriebsratsstrukturen an moderne Unternehmensformen ist ein legitimes Anliegen. Allerdings droht der Antrag, neue bürokratische Hürden zu schaffen. Die Einführung zusätzlicher Gremien oder die Ausweitung von Zuständigkeiten kann zu Kompetenzstreitigkeiten und Ineffizienzen führen. Arbeitgeber benötigen klare, handhabbare Strukturen – keine komplexen Mitbestimmungsarchitekturen, die betriebliche Bürokratie vervielfachen.
Fazit
Die Entschließung des Bundesrates hat mit Modernisierung des BetrVG nicht viel zu tun. Es geht allein um eine massive Ausweitung von Beteiligungsrechten – abgesehen von der sinnvollen Stärkung digitaler Betriebsratsarbeit enthält die Entschließung keine Ansätze, die der deutschen Wirtschaft im aktuellen Krisen- und Wettbewerbsumfeld helfen würden. Unter dem Deckmantel der Digitalisierung wird eine tiefgreifende Erweiterung der Mitbestimmungsrechte forciert, die weder rechtlich noch von ihren Folgen her ausreichend durchdacht zu sein scheint. Statt eines „Mehr“ an Regulierung braucht es ein „Besser“: Klare, praktikable Regeln, die sowohl die Rechte der Beschäftigten wahren als auch die Handlungs- und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sichern und nicht beschneiden. Aus Arbeitgebersicht bringt der Entschließungsbeschluss in erster Linie mehr Rechtsunsicherheit, viel mehr Bürokratie, weitere Innovationshemmnisse und neue Konfliktpotenziale. Eine Reform des BetrVG ist notwendig. Sie muss aber ausgewogen, praxistauglich und innovationsfreundlich sein. Die vorliegende Initiative erfüllt diese Anforderungen nicht – sie möge lediglich eine Entschließung bleiben.
RA FAArbR Dr. Ulrich Sittard ist Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht im DAV. Die Arbeitsgemeinschaft, ein Kooperationspartner des Arbeits-Rechtsberaters, lädt regelmäßig zu Fortbildungsveranstaltungen mit interdisziplinärem Austausch ein. Die Herbsttagung 2025 findet am 12. und 13. September 2025 in Prag statt (Programm, Anmeldung).