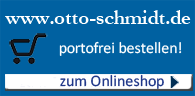In der Praxis ist in letzter Zeit vermehrt zu beobachten, dass es zur Überzahlung von Entgeltfortzahlung bei längerer Arbeitsunfähigkeit von Arbeitnehmern kommt. Grund ist, dass einzelne Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen während eines längeren Zeitraums zwischendurch immer einmal wieder als Erstbescheinigung ausgestellt sind. Das liegt mutmaßlich daran, dass verschiedene Ärzte die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen ausgestellt haben, was für den Arbeitgeber anhand der elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht ersichtlich ist. Unerheblich ist, ob der Arbeitnehmer bewusst den Arzt wechselt, um in den Genuss einer längeren Entgeltfortzahlung zu kommen.
Die nach § 69Abs. 4 SGB X mögliche Vorerkrankungsanfrage bei der Krankenkasse hilft erfahrungsgemäß nicht weiter, weil sich die Krankenkassen dabei mutmaßlich auch nur daran orientieren, ob der Entgeltfortzahlungszeitraum von sechs Wochen seit der letzten als Erstbescheinigung ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung abgelaufen ist. In Personalabteilungen ist unglücklicherweise der Irrtum weit verbreitet, dass die Auskunft der Krankenkassen verbindlich ist. Stellt sich dann bei einer nachträglichen Prüfung heraus, dass der Arbeitnehmer möglicherweise zu viel Entgeltfortzahlung erhalten hat, gehen Arbeitgeber wie selbstverständlich davon aus, einen Rückzahlungsanspruch zu haben. Unter Berücksichtigung der prozessualen Darlegungs- und Beweislast ist das allerdings alles andere als sicher.
1. Ausgangslage
Der Arbeitnehmer hat nach Erfüllung der vierwöchigen Wartezeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 EFZG einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung für sechs Wochen, wenn er krankheitsbedingt arbeitsunfähig ist.
Der Entgeltfortzahlungszeitraum von sechs Wochen entsteht für jede neue Krankheit des Arbeitnehmers von vorn. Es ist also keineswegs so, dass der Arbeitgeber höchstens sechs Wochen zur Entgeltfortzahlung verpflichtet ist.
Kein neuer Entgeltfortzahlungszeitraum entsteht bei einer sogenannten Einheit des Verhinderungsfalls. Ein solcher liegt vor, wenn der Arbeitnehmer während einer Arbeitsunfähigkeit an einer weiteren (neuen) Krankheit erkrankt, die zur Arbeitsunfähigkeit führenden Erkrankungen sich also überlappen. Darüber hinaus hat der Arbeitnehmer ausnahmsweise unter den weiteren Voraussetzungen von § 3 Abs. 1 Satz 2 EFZG einen Anspruch auf Entgeltfortzahlung für einen weiteren Zeitraum von sechs Wochen, wenn er infolge derselben Krankheit erneut arbeitsunfähig wird. Dafür darf er entweder nach § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 EFZG mindestens sechs Monate vor der erneuten Arbeitsunfähigkeit nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig gewesen sein oder es sind seit dem Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit zwölf Monate vergangen, § 3 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 EFZG. In jedem Fall muss es sich um eine erneute Arbeitsunfähigkeit handeln. Der Arbeitnehmer muss also zwischenzeitlich arbeitsfähig gewesen sein. Ein erneuter Anspruch auf Entgeltfortzahlung entsteht also keineswegs bei einer Dauererkrankung nach einem Zeitraum von zwölf Monaten, wie § 3 Abs. 1 Satz 2 EFZG bei einer flüchtigen Lektüre verstanden werden könnte.
2. Darlegungs- und Beweislast im Entgeltfortzahlungsrechtsstreit
Der Arbeitnehmer hat nach allgemeinen Grundsätzen die Voraussetzungen eines Entgeltfortzahlungsanspruchs im Rechtsstreit darzulegen und erforderlichenfalls zu beweisen. Der Arbeitnehmer kann die ihn treffende Darlegungslast zunächst durch Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfüllen. Dieser kommt ein hoher Beweiswert zu. Der Arbeitnehmer muss erst dann zu der von ihm behaupteten krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit näher vortragen, wenn der Arbeitgeber den Beweiswert der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch die Darlegung von Umständen erschüttert, die Zweifel an der Arbeitsunfähigkeit begründen.
Die Grundsätze gelten auch hinsichtlich der Frage, ob eine Einheit des Verhinderungsfalls oder eine erst nach dem Ende der vorausgegangenen Krankheit aufgetretenen neuen Krankheit vorliegt, sodass ein neuer Entgeltfortzahlungszeitraum begonnen hat. Der Arbeitnehmer hat darzulegen, dass es sich um eine neue, erst nach dem Ende einer vorausgegangenen Krankheit aufgetretenen Krankheit handelt, die seine Arbeitsunfähigkeit begründet hat. Seine Darlegungslast kann er wiederum zunächst durch die Vorlage einer als Erstbescheinigung ausgestellten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erfüllen. Der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kommt auch insoweit ein Beweiswert zu, dass es sich um eine neue Krankheit handelt.
Dem Arbeitnehmer obliegt allerdings dann der volle Beweis für das Ende der vorausgegangenen und den Beginn der neuen Krankheit, wenn der Arbeitgeber wichtige Indizien dafür vorträgt, dass ein einheitlicher Verhinderungsfall vorliegt. Als ein gewichtiges Indiz in diesem Sinne anerkannt ist, wenn sich an einer Arbeitsverhinderung eine dem Arbeitnehmer im Wege einer Erstbescheinigung attestierte weitere Arbeitsunfähigkeit dergestalt anschließt, dass die Arbeitsverhinderung unmittelbar aufeinanderfolgen oder zwischen ihnen nur ein für den Arbeitnehmer arbeitsfreier Tag oder ein arbeitsfreies Wochenende liegt.
Fraglich ist, ob das auch gilt, wenn zwischen der vorausgegangenen und der erneuten Krankheit ein (ein- oder sogar mehrwöchiger) Urlaub liegt, ein Szenario, das in der Praxis auch immer häufiger zu beobachten ist. Auch in dem Fall dürfte den Arbeitnehmer der volle Beweis obliegen. Denn das Bundesarbeitsgericht nimmt ein gewichtiges Indiz deshalb an, weil es für den Arbeitgeber mangels fehlender zwischenzeitlicher Arbeitspflicht des Arbeitnehmers nahezu unmöglich ist, konkrete Anhaltspunkte zur Erschütterung des Beweiswerts vorzutragen. Das ist bei einem arbeitsfreien Tag bzw. einem arbeitsfreien Wochenende zwischen den Arbeitsunfähigkeiten genauso wie bei einem zwischenzeitlichen Urlaub.
Die Darlegungs- und Beweislast ist hingegen hinsichtlich der Frage anders verteilt, ob es sich um eine Fortsetzungserkrankung im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 EFZG handelt. Der Arbeitgeber hat eine Fortsetzungserkrankung zu beweisen. Ein Non-Liquid geht zu seinen Lasten. Es gilt allerdings eine abgestufte Darlegungslast, wenn der Arbeitnehmer innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten länger als sechs Wochen arbeitsunfähig krank ist. Dann reicht es aus, wenn der Arbeitgeber das Vorliegen einer Neuerkrankung bestreitet. Dem Arbeitnehmer obliegt in dem Fall die Darlegung von Tatsachen, die den Schluss erlauben, es handele sich nicht um eine Fortsetzungserkrankung. Kommt er dieser abgestuften Darlegungslast nicht nach, ist von einer Fortsetzungserkrankung mit der Folge auszugehen, dass ein Entgeltfortzahlungsanspruch nur unter den weiteren Voraussetzungen von § 3 Abs. 1 Satz 2 EFZG besteht.
3. Rückzahlungsanspruch bei der Überzahlung von Entgeltfortzahlung
Der Arbeitgeber hat gegen den Arbeitnehmer nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB einen Anspruch auf Rückzahlung zu viel gezahlter Entgeltfortzahlung. Leistet der Arbeitgeber Entgeltfortzahlung, ohne dass der Arbeitnehmer einen Anspruch darauf hat, erlangt der Arbeitnehmer etwas ohne Rechtsgrund. Ein Rückzahlungsanspruch wird in der Regel nicht nach § 814 BGB ausgeschlossen sein, wonach das Geleistete nicht zurückgefordert werden kann, wenn der Leistende Kenntnis von der Nichtschuld hatte. Denn dafür ist eine positive Kenntnis der Rechtslage im Zeitpunkt der Leistung erforderlich. Der Leistende muss wissen, dass er nach Rechtslage nicht schuldet. Er hat aus den ihm bekannten Tatsachen eine im Ergebnis zutreffende rechtliche Schlussfolgerung zu ziehen, wobei allerdings eine entsprechende „Parallelwertung in der Laiensphäre“ reicht. Auch der Entreicherungseinwand nach § 818 Abs. 3 BGB dürfte einem Rückzahlungsanspruch in der Regelung nicht entgegenstehen, weil das Erlangte dafür ersatzlos weggefallen sein muss. Das Vermögen des Arbeitnehmers darf also infolge der rechtsgrundlosen Zahlung keine Verbesserung mehr enthalten.
4. Darlegungs- und Beweislast im RĂĽckzahlungsrechtsstreit
Der Arbeitgeber muss im Rückzahlungsrechtsstreit nach allgemeinen Grundsätzen das Fehlen eines Rechtsgrundes darlegen und erforderlichenfalls beweisen. Das gilt auch hinsichtlich des Fehlens eines Rechtsgrundes. Geklärt ist, dass dem Arbeitnehmer insoweit eine sekundäre Darlegungslast trifft. Der Arbeitgeber muss deshalb nur den Rechtsgrund widerlegen, der sich für die empfangende Leistung aus dem Vortrag des Arbeitnehmers ergibt. Für den Arbeitgeber ist damit im Rückzahlungsrechtsstreit allerdings in der Regel wenig gewonnen, weil klar ist, dass Rechtsgrund nur § 3 Abs. 1 EFZG sein kann.
Die „Musik“ spielt vielmehr bei der Frage, ob eine Einheit des Verhinderungsfalls oder eine neue Erkrankung vorliegt. Die Erkenntnismöglichkeiten des Arbeitgebers hinsichtlich der relevanten Tatsachen sind begrenzt, weil diese außerhalb seiner Wahrnehmungsmöglichkeiten liegen. Den Arbeitnehmer wird man nicht aufgrund einer ihn treffenden sekundären Darlegungslast zu nähren Angaben über seine Krankheiten verpflichtet halten können, weil das voraussetzt, dass ihm das zumutbar ist (vgl. BGH, Urt. v. 8.3.2021 – VI ZR 505/19, ZIP 2021, 799 Rz. 27). Eine Auskunft über die im Datenschutzrecht nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO als sensible Daten einem besonderen Schutz unterliegende Gesundheitsdaten ist dem Arbeitnehmer im Zweifel nicht zumutbar und kann ihm deshalb prozessual wohl nicht abverlangt werden.
Es stellt sich deshalb die Frage, ob über die sekundäre Darlegungslast des Arbeitnehmers hinaus auch die Grundsätze der Darlegungslast für einen Entgeltfortzahlungsanspruch im Rückzahlungsrechtsstreit gelten. Konkret: Obliegt dem Arbeitnehmer im Rückzahlungsrechtsstreit der volle Beweis für das Ende der vorausgegangenen und den Beginn der neuen Krankheit, wenn der Arbeitgeber gewichtige Indizien dafür vorträgt, dass ein einheitlicher Verhinderungsfall vorliegt? Die Frage war soweit ersichtlich in der Rechtsprechung bisher nur Gegenstand von zwei veröffentlichten Entscheidungen. Das Bundesarbeitsgericht hat sich mit ihr noch nicht befasst. In der Literatur findet sich ebenfalls keine Diskussion. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat eine sekundäre Darlegungslast in Anlehnung an die im Rahmen von § 3 EFZG geltende Verteilung der Darlegungs- und Beweislast im Rückzahlungsrechtsstreit angenommen (LAG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 5.7.2024 – 12 Sa 1266/23). Das Arbeitsgericht Köln hat das hingegen abgelehnt und hält den Arbeitgeber im Rückzahlungsrechtsstreit für voll darlegungs- und beweisbelastet für die anspruchsbegründenden Tatsachen und damit auch für den fehlenden Rechtsgrund; die Anwendung der Beweislastverteilung wie in § 3 EFZG hat es nicht angewendet (ArbG Köln v. 16.1.2025 – 8 Ca 4803/24).
Es sprechen wohl die besseren Gründe für die Ansicht des Arbeitsgerichts Köln, weil andernfalls die im Rahmen von § 812 Abs. 1 BGB nach allgemeinen Grundsätzen geltende Beweislast ausgehebelt und ins Gegenteil verkehrt werden würde. Der Arbeitnehmer würde ansonsten das Risiko tragen, im Rückzahlungsrechtsstreit eine ihn treffende Darlegungs- und Beweislast für die Voraussetzungen des Entgeltfortzahlungsanspruchs erfüllen zu können. Die Zahlung stellt aber eine Zäsur dar. Mit der Zahlung gibt der Arbeitgeber zu erkennen, selbst von einer Pflicht auszugehen. Andernfalls würde sowieso die Kenntnis der Nichtschuld nach § 814 BGB einem Rückzahlungsanspruch entgegenstehen. Das kann nicht ohne Auswirkungen auf die Darlegungs- und Beweislast im Rückzahlungsrechtsstreit bleiben. Die Grundsätze der Darlegungs- und Beweislast im Rahmen des Entgeltfortzahlungsanspruchs können deshalb nicht in den Rückzahlungsrechtsstreit „transformiert“ werden. Dem Arbeitgeber kommt über die sekundäre Darlegungslast des Arbeitnehmers, den Rechtsgrund für die erhaltene Zahlung zu benennen, keine weiteren Erleichterungen bei der Darlegung und dem Beweis der Voraussetzungen für einen Anspruch auf Rückzahlung zu viel gezahlter Entgeltfortzahlung nach § 812 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 BGB zu. Das muss aus den gleichen Erwägungen über das Arbeitsrecht hinaus auch allgemein für die Verteilung der Darlegungs- und Beweislast in Rückzahlungsrechtsstreitigkeiten gelten, weil andernfalls jeder Leistungsempfänger das Risiko tragen müsste, im Rückzahlungsrechtsstreit die Voraussetzungen für den (vermeintlichen) Rechtsgrund nicht beweisen zu können, was alles andere als billig wäre.
Es ist davon auszugehen, dass der Arbeitgeber in der Regel Schwierigkeiten haben wird, die relevanten Tatsachen fĂĽr das Fehlen eines Rechtsgrunds darzulegen, weil er sie nicht kennt.
5. Schlussfolgerung
Daraus folgt, dass Arbeitgeber gut beraten sind, vor der weiteren Leistung von Entgeltfortzahlung bei einer durchgehenden oder nur durch Urlaub unterbrochenen Arbeitsunfähigkeit von über sechs Wochen kritisch zu hinterfragen, ob eine Einheit des Verhinderungsfalls mit der Folge vorliegt, dass nach dem Ende des Entgeltfortzahlungszeitraums von sechs Wochen kein Entgeltfortzahlungsanspruch mehr besteht, bevor an den Arbeitnehmer gezahlt wird.
Arbeitgeber sollten sich nicht darauf verlassen, zu viel gezahlte Entgeltfortzahlung mit Erfolg zurückfordern zu können. Die Risiken im Rückzahlungsrechtsstreit sind hoch, weil sie im Einzelfall Schwierigkeiten haben werden, das Fehlen eines Rechtsgrundes darzulegen. Der Arbeitgeber sollte dem Arbeitnehmer vor Zahlung vielmehr unter Hinweis auf die im Streitfall im Rahmen des Entgeltfortzahlungsanspruchs geltende Darlegungs- und Beweislast Gelegenheit geben, die Umstände zu benennen, aus denen sich ergeben soll, dass kein einheitlicher Verhinderungsfall vorliegt. Kommt der Arbeitnehmer dem nicht nach, kann dem Arbeitgeber bei Einstellung der Zahlung kein Vorwurf gemacht werden, so dass er mangels eines Vertretenmüssens nach § 286 Abs. 4 BGB nicht in Zahlungsverzug gerät.
_______________________________________________________________________
Sven Luckert, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht, OPPENLÄNDER Rechtsanwälte, Stuttgart