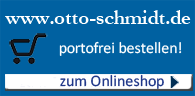Mit dem Inkrafttreten des Berufsbildungsvalidierungs- und -digitalisierungsgesetzes (BVaDiG) zum 1. August 2024 hat das Berufsbildungsgesetz (BBiG) tiefgreifende Neuerungen erfahren, die Unternehmen neue Wege eröffnen, Auszubildende zu gewinnen und Ausbildung attraktiver zu gestalten. Insbesondere die Möglichkeit des digitalen mobilen Ausbildens bietet Personalverantwortlichen praxisnahe, flexible Instrumente zur Modernisierung ihrer Ausbildungskonzepte – und damit zur Positionierung als innovativer Ausbildungsbetrieb.
Digitales mobiles Ausbilden – ein neuer Standard
Erstmals wird gesetzlich klargestellt: Ausbildungsinhalte können auch ortsunabhängig vermittelt werden, ohne dass Ausbilder und Auszubildender gleichzeitig am selben Ort anwesend sein müssen (§ 28 BBiG). Voraussetzung ist, dass geeignete Informationstechnik eingesetzt wird, die Kommunikation zu betriebsüblichen Zeiten erlaubt und eine strukturierte Begleitung des Lernprozesses durch den Ausbildenden sicherstellt.
Gestaltungsspielräume für Ausbildungsverantwortliche
Der Ausbildende entscheidet frei, ob und in welchem Umfang digitale mobile Ausbildung eingesetzt wird. Eine Zustimmung des Auszubildenden oder der zuständigen Stelle ist nicht erforderlich – das Prinzip der „einfachen Freiwilligkeit“ stärkt die unternehmerische Flexibilität. Auch der Zeitpunkt ist frei wählbar: Das digitale mobile Ausbilden kann bereits in der Probezeit starten, um frühzeitig die Eignung des Auszubildenden für diese Lernform zu prüfen.
Begrenzung und Qualitätssicherung
Wichtig ist: Digitale mobile Ausbildung darf die Präsenz nicht vollständig ersetzen – sie muss „in angemessenem Umfang“ erfolgen. Was „angemessen“ ist, definiert das Gesetz bewusst offen. Unternehmen können also passgenau auf Beruf, Branche und innerbetriebliche Gegebenheiten reagieren. Gleichzeitig muss stets die Gleichwertigkeit der Ausbildung gewahrt bleiben: Die Qualität der Vermittlung darf nicht hinter der Präsenzform zurückstehen. Dies setzt eine verlässliche technische Infrastruktur, gute didaktische Konzepte und aktives Ausbildungsmonitoring voraus.
Technische Ausstattung und Lernumgebung
Der Ausbildende ist verpflichtet, dem Auszubildenden die für das digitale mobile Ausbilden notwendige Hard- und Software kostenlos zur Verfügung zu stellen (§ 14 BBiG). Nicht umfasst sind laufende Nutzungskosten (z. B. Internet, Mobiliar), die der Auszubildende selbst trägt. Wichtig für die Umsetzung: Ausbildungsorte müssen für konzentriertes Arbeiten geeignet sein – Lärm, mangelnde Privatsphäre oder schlechte Internetverbindung können eine ordnungsgemäße Ausbildung gefährden. Es empfiehlt sich, ungeeignete Orte im Vorfeld klar auszuschließen.
Ortsunabhängigkeit – auch im Ausland möglich
Das Gesetz kennt keine territoriale Begrenzung – theoretisch kann die digitale mobile Ausbildung auch aus dem Ausland erfolgen. Da dies rechtlich heikel sein kann und Missverständnisse über „Arbeiten im Urlaub“ vermeiden werden sollten, empfiehlt es sich, mobile Ausbildung auf das Inland zu beschränken oder Auslandseinsätze nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung zuzulassen.
Ausbildungsinhalte und -berufe – nicht alles geht digital
Nicht alle Ausbildungsinhalte eignen sich für mobiles Lernen. Der praktische Umgang mit Maschinen oder Kundenkontakt im Einzelhandel sind Beispiele, bei denen Präsenz weiterhin notwendig ist. Personalverantwortliche sollten daher bei der Planung sorgfältig prüfen, welche Inhalte digital vermittelbar sind und wo eine virtuelle Lösung praktikabel ist. Hier können auch technologische Entwicklungen (z. B. VR-Lösungen) in Zukunft neue Perspektiven eröffnen.
Gesetzliche Rahmenbedingungen bleiben bestehen
Auch bei digitaler mobiler Ausbildung gelten alle Regelungen des BBiG weiter: Anforderungen an Ausbildungsstätte, Ausbildungspersonal sowie arbeits- und jugendschutzrechtliche Vorschriften (z. B. ArbZG, JArbSchG, SGB IX, ArbStättV) sind weiterhin bindend. Wichtig: Ausbilder müssen ggf. methodisch-didaktisch für digitale Medien geschult sein, ein entsprechendes Konzept ist zu erarbeiten.
Zusatzqualifikationen und Ausbildungsordnung
Die Ausbildungsordnung (§ 5 BBiG) kann genutzt werden, um digitale Inhalte und Kompetenzen – z. B. im Bereich Künstliche Intelligenz oder spezielle Software – als Wahlbausteine zu integrieren. So lassen sich Ausbildungsprofile modernisieren und digitale Kompetenzen gezielt fördern. Dies kann den Einstieg in mobile Ausbildungsphasen erleichtern oder erweitern.
Fazit fĂĽr Personalverantwortliche
Die Neuregelungen eröffnen Unternehmen große Chancen, sich als moderne, flexible und digitale Ausbildungsbetriebe zu positionieren. Mit einem gut durchdachten Konzept zur digitalen mobilen Ausbildung lassen sich neue Zielgruppen erschließen – insbesondere digital affine junge Menschen, die Flexibilität und Eigenverantwortung schätzen. Gleichzeitig erlaubt das Gesetz eine passgenaue, betriebsspezifische Umsetzung unter Wahrung der Qualitätsstandards. Entscheidend ist, diese Gestaltungsmöglichkeiten aktiv zu nutzen, um als Arbeitgeber im Wettbewerb um Talente zu bestehen.
Ausf. zu allen neuen Möglichkeiten der Digitalisierung im Berufsbildungsgesetz (BBiG):
Kleinebrink, „Gestaltung der Berufsausbildung mit neuen gesetzlichen Möglichkeiten der Digitalisierung, Der Betrieb (DB) 2025, 1822 (Heft 30)