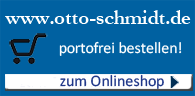Aktuell in der ZFA
Verstaatlichung der Lohnpolitik - Grundrechtliche und unionsrechtliche Rahmenbedingungen (Franzen, ZFA 2024, 156)
Die Festsetzung des Arbeitsentgelts ist grundsätzlich den Arbeitsvertrags- bzw. Tarifvertragsparteien vorbehalten. Gleichwohl kann der Staat durch verschiedene Instrumente auf die Lohnpolitik zugreifen: durch staatliche Mindestlöhne aufgrund Gesetz, durch Zusammenwirken mit den Tarifvertragsparteien im Wege der Allgemeinverbindlicherklärung oder Rechtsverordnung nach AEntG (sog. kooperative Rechtssetzung) sowie indem der Staat Anreize in seinem Beschaffungswesen setzt (insbesondere durch Tariftreueregelungen). Der Beitrag behandelt die grundrechtlichen und unionsrechtlichen Rahmenbedingungen derartiger Instrumente.
I. Einleitung
II. Bestandsaufnahme
1. Staatliche Lohnfestsetzung
2. Kooperative Rechtssetzung von Staat und Tarifvertragsparteien
a) Allgemeines
b) Der Sonderfall der Pflege: § 7a Abs. 1a AEntG
3. Anreizsetzung im staatlichen Beschaffungswesen (Tariftreueregelungen)
a) Überblick
b) Landesrechtliche Vergaberegelungen
c) § 72 Abs. 3b SGB XI
III. Vorgaben der Grundrechte des Grundgesetzes
1. Art. 9 Abs. 3 GG: Tarifautonomie
a) Positive Koalitionsfreiheit
aa) Das MiLoG 2014/2015
bb) Das Mindestlohnerhöhungsgesetz 2022
cc) Exkurs: Weitere Kommissionen mit vergleichbaren Aufgaben wie die Mindestlohnkommission
b) Negative Koalitionsfreiheit
2. Art. 12 GG: Freiheit der Gestaltung der Arbeitsverträge
a) Der Beschluss des BVerfG vom 11.7.2006
b) Das Beispiel der Pflege
3. Zwischenergebnis
IV. Vorgaben des Unionsrechts
1. Art. 153 Abs. 5 AEUV
a) Bisherige Rechtsprechung des EuGH zu Art. 153 Abs. 5 AEUV
b) Die Klage des Königreichs Dänemark gegen die EU-Mindestlohnrichtlinie 2022/2041
2. Arbeitnehmer-Entsenderichtlinie 96/71/EG
a) Rechtsprechung des EuGH im Zusammenhang mit Vergaberegelungen: „Rüffert“, „Bundesdruckerei“ und „RegioPost“
aa) Die einzelnen Urteile
bb) Folgerungen
b) Art. 3 Abs. 8 Unterabs. 2 RL 96/71/EG
c) Das Beispiel Pflege: Das regional übliche Entgeltniveau nach § 72 Abs. 3b S. 1 Nr. 4 SGB XI und Art. 3 Abs. 1 Unterabs. 1 lit. c RL 96/71/EG
V. Schlussbetrachtung
I. Einleitung
Die Lohnfindung in Deutschland und vielen ähnlich ausgerichteten Rechtsordnungen ist überwiegend den Tarifvertragsparteien anvertraut und beruht auf der in Art. 9 Abs. 3 GG verankerten Tarifautonomie – in den Worten des BAG:
„Die autonome vergütungsrechtliche Bewertung einzelner Tätigkeiten ist integraler Bestandteil der Tarifautonomie. Der Möglichkeit der staatlichen Gewalt einschließlich der Judikative, den Tarifvertragsparteien in diesem Bereich Vorgaben zu machen, sind enge Grenzen gezogen. In Betracht kommen vor allem sozialstaatliche Erwägungen. Dagegen ist nach der Konzeption des Grundgesetzes die Festlegung der Höhe des Entgelts grundsätzlich den Tarifvertragsparteien übertragen, weil dies nach Überzeugung des Verfassungsgebers zu sachgerechteren Ergebnissen führt als eine staatlich beeinflusste Lohnfindung (vgl. BVerfG 26. Juni 1991 – 1 BvR 779/85 – BVerfGE 84, 212, 224; 4. Juli 1995 – 1 BvF 2/86 ua. BVerfGE 92, 365, 393).“
Dieser Grundsatz – Lohnfindung als Aufgabe der Tarifvertragsparteien – ist auch in das EU-Primärrecht eingeflossen: Art. 153 Abs. 5 AEUV verhindert die sozialpolitische Rechtssetzung der EU in Bezug auf das „Arbeitsentgelt“. Dies beruht darauf, dass die Festsetzung des Arbeitsentgelts Sache der Vertragsautonomie der Sozialpartner auf nationaler Ebene ist. Andererseits ist eine gewisse staatliche Einflussnahme auf die tarifliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen einem solchen System aber auch nicht fremd. Das klassische Instrument hierfür stellt die Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen dar, welches ebenfalls zahlreiche Rechtsordnungen und auch das Unionsrecht in Art. 3 Abs. 8 Unterabs. 1 RL 96/71/EG kennen. In den letzten Jahren verstärkt sich aber die Tendenz staatlicher Zugriffe auf die Lohnfindung.
II. Bestandsaufnahme
1. Staatliche Lohnfestsetzung
Diesen Zugriff kann man rechtlich in mehrere Kategorien fassen: Zunächst kann der Staat direkt Arbeitsentgelte festsetzen, was sich bereits auf Grund der soeben kurz wiedergegebenen verfassungsrechtlichen Lage im Wesentlichen auf Mindestentgelte zur Gewährleistung des existenzsichernden Lebensunterhalts beschränken muss und auch tatsächlich beschränkt.
Hierher gehören der gesetzliche Mindestlohn nach dem MiLoG und der branchenspezifische Pflegemindestlohn nach §§ 10 ff. AEntG ; außerhalb des engeren Bereichs des Arbeitsrechts die bindenden Festsetzungen der Heimarbeitsausschüsse nach § 19 HAG und auch die Festsetzung eines Ausbildungsmindestentgelts in § 17 BBiG. Außerdem kann man hier den relativen Mindestlohn nach §§ 138, 612 BGB aufgrund Sittenwidrigkeit von Arbeitsentgeltvereinbarungen nach der Rechtsprechung des BAG einordnen. § 17 BBiG stellt in zweierlei Hinsicht einen Sonderfall dar. Zunächst ist das staatlicherseits festgesetzte Arbeitsentgelt nach § 17 Abs. 3 BBiG tarifdispositiv, allerdings nur für den nach § 3 Abs. 1 TVG tarifgebundenen Ausbildenden, und nicht im Wege von Bezugnahmevereinbarungen. Außerdem wird die Höhe der Entgeltsätze explizit im Gesetz in § 17 Abs. 2 BBiG genannt.
In den meisten Fällen ist die eigentliche Findung der Entgelthöhe Kommissionen anvertraut, die sich paritätisch aus Vertretern von Arbeitgebern und Arbeitnehmern zusammensetzen. Mit der Einsetzung derartiger Kommissionen – der Mindestlohnkommission nach §§ 4 ff. MiLoG oder der Pflegemindestlohnkommission nach §§ 10 ff. AEntG – macht sich der Staat den Sachverstand der beteiligten Akteure zunutze. Diese werden nicht als Vertreter ihres Autonomiebereichs, sondern im staatlichen Auftrag tätig. Dies zeigt sich beispielsweise daran, dass die Mitglieder der Kommission nicht an Weisungen gebunden sind (§ 12 Abs. 3 S. 3 AEntG, § 8 Abs. 1 MiLoG). Einen stärkeren Staatseinfluss weisen die bindenden Festsetzungen der Heimarbeitsausschüsse nach § 19 HAG aufgrund ihrer Zusammensetzung und Beschlussfassung nach § 4 Abs. 2 HAG aus. Dies kann damit erklärt werden, dass hier nur ein loser Bezug zum engeren Bereich des Arbeitsrechts besteht und Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände nur selten relevante Akteure sind. Insgesamt kann man diese Formen noch als staatliche Rechtssetzung qualifizieren.
2. Kooperative Rechtssetzung von Staat und Tarifvertragsparteien
a) Allgemeines
Zum zweiten ist denkbar, dass Staat und Tarifvertragsparteien zusammenwirken, insbesondere indem die tarifvertragliche Regelung durch staatliche Instrumente verstärkt wird. Beispiele hierfür sind die Allgemeinverbindlicherklärung nach § 5 TVG und Rechtsverordnungen nach dem AEntG oder die Lohnuntergrenze nach § 3a AÜG. Man kann dies als „kooperative Rechtssetzung“ bezeichnen: Die Tarifvertragsparteien liefern den Inhalt und zumeist auch die Rechtsform und der Staat das rechtsförmige Instrument zur Legitimation gegenüber denjenigen Adressaten, welche...