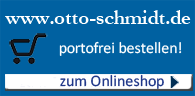Aktuell im ArbRB
Nahostkonflikt in den Betrieben - Zum schwierigen Verhältnis von Meinungsfreiheit und Betriebsfrieden im Kontext politischer Äußerungen (Grimm/Krülls/Schwanke, ArbRB 2023, 334)
Nach dem Überfall der Hamas auf israelisches Gebiet und den zwischenzeitlich erfolgten Gegenschlägen ist zu erwarten, dass es auch in deutschen Betrieben zu politischen Stellungnahmen kommt. Werden dabei die Grenzen der Meinungsfreiheit überschritten, stellt sich die Frage nach arbeitsrechtlichen Konsequenzen. Der Beitrag behandelt das schwierige Verhältnis von Meinungsfreiheit und Betriebsfrieden im Kontext politischer Äußerungen, ordnet gängige propalästinensische Parolen rechtlich ein und untersucht, wann Maßnahmen des Arbeitgebers und des Betriebsrats erfolgversprechend sind.
I. Meinungsfreiheit vs. Betriebsfrieden
1. Grundsätze
2. Störung durch beharrliche Provokation
a) Der „Strauß-Plakettenfall“
b) Konsequenzen
3. Beurteilung singulärer Äußerungen
4. Außerbetriebliche Äußerungen, insb. Social Media
5. Besonderheiten im öffentlichen Dienst
II. Mögliche arbeitsrechtliche Folgen politischer Äußerungen
1. Abmahnung
2. Außerordentliche und (hilfsweise) ordentliche Kündigung
3. § 104 Satz 1 BetrVG
4. Beispiele aus der Instanzrechtsprechung
III. Bewertung typischer Parolen und Symbole
IV. Fazit
I. Meinungsfreiheit vs. Betriebsfrieden
1. Grundsätze
Die arbeitsrechtliche Beurteilung politischer Äußerungen steht im Spannungsfeld mit dem Recht der Arbeitnehmer auf freie Meinungsäußerung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG. Auch im Betrieb gilt die Meinungsfreiheit im Wege der mittelbaren Drittwirkung über die arbeitsrechtlichen Generalklauseln. Sie wird nicht schrankenlos gewährt, sondern gem. Art. 5 Abs. 2 GG durch die allgemeinen Gesetze und das Recht der persönlichen Ehre beschränkt.
§ 241 Abs. 2 BGB gehört – ebenso wie § 75 BetrVG – zu diesen allgemeinen Gesetzen und statuiert die vertragliche Nebenpflicht, den Betriebsfrieden nicht zu stören. Dieser Begriff beschreibt das störungsfreie Zusammenleben im Betrieb unter Berücksichtigung der schutzwürdigen Interessen aller Beteiligten. Selbst Äußerungen mit schwerwiegenden Folgen für das betriebliche Miteinander können jedoch nur dann eine Störung des Betriebsfriedens darstellen, wenn sie aufgrund der Form – insbesondere ihrer Häufigkeit – oder des Inhalts an sich nicht berechtigt sind.
2. Störung durch beharrliche Provokation
a) Der „Strauß-Plakettenfall“
Das BAG hatte sich mit dieser Spannungslage wegweisend im sog. „Strauß-Plakettenfall“ auseinanderzusetzen: Ein Arbeitnehmer war im Bundestagswahlkampf 1980 mit einem am Oberkörper angebrachten Aufruf zur Nicht-Wahl der damals von Franz Josef Strauß angeführten Unionsparteien („Stoppt Strauß“) im Betrieb erschienen. Trotz wiederholter Abmahnungen hatte er die Plakette weitergetragen.
Das BAG sah in diesem beharrlichen Verhalten einen Grund zur Kündigung. Zur Erfüllung des Arbeitsvertrags gehöre die Verpflichtung, den Betrieb nicht zu stören. In der Beharrlichkeit des Arbeitnehmers liege eine über die Kundgabe der eigenen politischen Überzeugung hinausgehende Provokation.
b) Konsequenzen
Darauf aufbauend ist nunmehr anerkannt, dass das Interesse an einer freien Meinungsäußerung gegen den Betriebsfrieden abgewogen werden muss. Praktische Konkordanz wird über die in § 241 Abs. 2 BGB geregelte Rücksichtnahmepflicht geschaffen. Relevant ist dabei, ob es nur zu einer Gefährdung des Betriebsfriedens oder tatsächlich zu konkreten Verwerfungen kam.
Eine beharrliche Störung des Betriebsfriedens liegt vor, wenn ein Arbeitnehmer andere Mitarbeiter durch ständige Angriffe auf ihre politische Überzeugung oder religiöse Einstellung reizt, dadurch eine erhebliche Unruhe in der Belegschaft hervorruft und so...